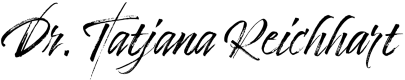Immer mehr Mitarbeitende leiden an psychischen Erkrankungen.
Die Rate an Arbeitsunfähigkeitstagen (AU-Tage) aufgrund von psychischen Erkrankungen ist zwischen 2009 und 2018 um ca. 60% angestiegen ohne dass eine Stagnation in Sicht ist. Aktuell muss man mit durchschnittlich 299 Krankheitstagen aufgrund von psychischen Erkrankungen pro Jahr pro 100 Mitarbeiter*innen rechnen, wie der aktuelle Fehlzeitenreport der AOK aufzeigt. Nach Angaben der deutschen Rentenversicherung hat auch der Anteil psychischer und psychosomatischer Erkrankungen an den Frühberentungen stark zugenommen, sodass mittlerweile fast jede zweite Frühberentung auf eine psychisch bedingte Erwerbsminderung zurückgeht. Als wären diese Zahlen nicht schon alarmierend genug, bildet sich in aktuellen, repräsentativen Umfragen unter deutschen Arbeitnehmer*innen ab, dass die subjektive Belastung noch viel höher liegt: mehr als 60 Prozent der Befragten fühlen sich oft gestresst und die Hälfte der Beschäftigten schätzt sich selbst als mäßig bis hoch Burnout-gefährdet ein und klagt über Beschwerden wie Rückenschmerzen, Erschöpfung oder Schlafstörungen. Viele meiner Klient*innen, die sich Unterstützung durch Coaching und Beratung suchen, sowie viele der Mitarbeiter*innen und Führungskräfte in den Unternehmen, die ich im Gesundheitsmanagement unterstütze, berichten vor allem vom Gefühl gehetzt und fremdbestimmt zu sein, nur noch To-do‘s abzuarbeiten und sie berichten von der Angst nicht mehr mitzukommen, abgehängt zu werden und „etwas“, oftmals sogar „ihr Leben“, zu verpassen.

Woher kommt dieses omnipräsente Gefühl von Überforderung, Sorgen und Hetze, ist die Arbeit „schuld“? Und sind wir damit eine psychisch kranke Gesellschaft (geworden)?
Ich möchte zunächst die zweite Frage beantworten und vor dem Hintergrund der Gesamtschau der Befunde verneinen. Fast alle wissenschaftlichen Ausführungen zu diesem Thema belegen, dass es heutzutage nicht mehr Menschen gibt, die an psychischen Erkrankungen leiden und dass die AU-Raten nicht die „wahre“ Prävalenz, also Krankheitshäufigkeit, wiederspiegeln. Weiterhin erkranken ungefähr ein Drittel der Bevölkerung irgendwann in ihrem Leben an einer diagnostizierbaren und behandlungsbedürftigen psychischen Erkrankung, am häufigsten treten Angsterkrankungen und Depression auf. Das war vor 15 bis 20 Jahren auch schon so. Allerdings holt sich immer noch nur die Minderheit der Betroffenen professionelle Hilfe, wie sich in repräsentativen epidemiologischen Studien gezeigt hat. Zu Hausärzten, Psychotherapeuten und Psychiatern kommen häufig die Menschen, die noch die Kraft aufbringen, Wartezeiten in Kauf zu nehmen und auch hartnäckig nach einem Psychotherapietermin zu verlangen. Und so spiegeln die AU-Bescheinigungen nicht die reale Krankheitslast einer Gesellschaft wider. Es wird diskutiert, dass immer mehr sogenannte „Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung“ in den Vordergrund rücken und zu Diagnosen werden und somit auf den AU-Bescheinigungen und in den Statistiken auftauchen. Ärzte scheinen besser zu differenzieren zwischen körperlichen Beschwerden und psychischen Hintergründen dieser Symptome, z.B. berücksichtigen sie bei Rückenschmerzen den stressassoziierten Kontext eher. Auch die Patienten scheinen eher bereit zu sein über ihre psychischen Probleme zu sprechen und eine „psychische“ Diagnose anzunehmen und nicht auf die körperliche Erklärung der Symptome zu bestehen. Früher hatte man Rücken, heute ein Burnout. Burnout – im Übrigen- ist keine anerkannte Diagnose, allerdings eine Vorstufe bzw. ein Risikofaktor für das Entstehen einer Depression, Angststörung oder anderer Erkrankungen.
Zusammenfassend können wir also festhalten, dass sich die gesellschaftliche Akzeptanz über psychische Beschwerden und Probleme zu reden und sich für diese Probleme – wenn sie denn nicht zu heftig sind – Unterstützung beim Arzt (inklusive Krankmeldung und eventuell Verordnung von Medikamenten) zu holen, erhöht hat und dass auch Ärzte sensibilisierter sind. Insgesamt kann dies vielfach dabei helfen psychische Erkrankungen frühzeitig zu erkennen und zu behandeln und damit einer Chronifizierung vorzubeugen. Kritisch anmerken möchte ich allerdings, dass gleichzeitig oft auch Probleme in der Bewältigung von schwierigen aber völlig normalen Lebensereignissen, zum Beispiel Konflikten, Todesfällen und Trauer, Trennungen und Stress am Arbeitsplatz, pathologisiert werden. Wirklich ernsthaft erkrankte Menschen, die an schweren Depressionen, Angststörungen oder Psychosen leiden, werden weiterhin stark stigmatisiert, stigmatisieren sich damit auch selbst und erhalten nicht zuletzt deswegen eher zu spät Hilfe.
Wenn wir nun eigentlich nicht psychisch kränker sind als früher, warum fühlen wir uns dann so sehr unter Druck, ausgebrannt und gestresst bis hin zu dem Gefühl, es nicht mehr zu schaffen, einfach nicht mehr „zu können“?
Auch dazu gibt es viel Diskussion und Spekulation. Die Veränderungen der Arbeitswelt und die Beschleunigung und zunehmende Komplexität, das hohes Maß an Unsicherheit und Instabilität, agile Arbeitsprozesse sowie weiterhin traditionelle, noch strak hierarchische und patriarchalische Unternehmenskulturen, in denen der Mensch als Ressource in den Hintergrund fällt, werden als Gründe aufgeführt. Unsere Welt ist volatil, unsicher, komplex und mehrdeutig (VUCA) geworden. Aber ist das neu? Waren unsere Vorfahren während der französischen Revolution und zwischen oder gar während der Weltkriege in stabileren Verhältnissen? Waren die Erfindungen der Dampflokomotive, des Telefons und des Automobils nicht auch mit Beschleunigung und Veränderung verbunden? Unterschätzen wir als Menschen der aktuellen Generationen vielleicht sogar unsere Resilienz, unsere seelische Widerstandsfähigkeit? Haben wir sogar vergessen oder gar nie gelernt, dass wir viel bewältigen und verkraften können, dass in Krisen Chancen liegen und sie uns sogar belastbarer für die Zukunft machen? Einige Autoren und Wissenschaftler sagen „ja“. Denn wir leben in unseren Breitengraden in den sichersten Zeiten überhaupt.
Mangelnde Wertschätzung und wenig Handlungsspielraum bei der Arbeit wirken sich negativ auf die Gesundheit aus
Noch nie war das Risiko an Mord und Krankheit zu sterben so gering wie aktuell. Noch nie waren wir sozial so gut abgesichert und haben in solch einem Überfluss gelebt, wie gerade jetzt. Und gleichzeitig sind wir einer Negativität anheimgefallen, die durch klassische und soziale Medien befeuert wird. Selbstverständlich hat auch der Arbeitskontext Einfluss auf uns. Wenn wir die wesentlichen Studien zu der Frage: „welche Faktoren am Arbeitsplatz wirken wirklich negativ auf unsere (psychische) Gesundheit aus“ zusammenfassen, bleibt eine interessante Erkenntnis übrig: es ist nicht die vermeintliche ständige Erreichbarkeit, es sind nicht mal die dauernden Unterbrechungen oder die Digitalisierung, die uns ängstigen und „fertig“ machen, es sind vor allem die mangelnde Wertschätzung (nach dem Psychologen Siegrist) und ein zu geringer Handlungsspielraum bei komplexen Aufgabestellungen (nach dem Psychologen Karasek). Es gibt eine Vielzahl von Studien, die zeigen, dass Menschen, die sich für ihren Job oder eine Aufgabe engagieren bzw. verausgaben und gefühlt zu wenig Wertschätzung (durch Lob und Anerkennung der Führungskräfte, durch einen angemessenen Lohn aber auch durch Arbeitsplatzsicherheit und Aufstiegschancen) zurückerhalten und / oder dass Menschen, die zu wenig selbst darüber bestimmen können, wie sie komplexe Aufgaben lösen, die z.B. Micro-Management und stark kontrollierenden Führungskräften und Strukturen unterworfen sind, in negativen Stress geraten. Dieser wiederum ist mit einer erhöhten Auftretenswahrscheinlichkeit von Depression, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und eventuell auch Angststörungen assoziiert. Kommt neben mangelnder Wertschätzung, zu geringem Handlungsspielraum noch Ungerechtigkeit dazu, dann erhöht sich damit sogar das Risiko aufgrund einer Depression frühverrentet zu werden. Insgesamt muss allerdings im Auge behalten werden, dass uns die Arbeit grundsätzlich gesund erhält! Arbeitslose Menschen, die damit aus sozialen Strukturen herausfallen, die in Unsicherheit mit Zukunftsangst und in Selbstzweifeln leben und die keiner sinnstiftenden Tätigkeit nachgehen können, werden häufiger psychisch krank.
Je mehr Stressoren von uns ferngehalten werden, umso weniger können wir lernen mit ihnen umzugehen
Wenn nun die Arbeitsplatzfaktoren nur zu einem Anteil dazu beitragen, dass wir uns so überfordert und gestresst fühlen, Ängste, Sorgen und Schlafstörungen haben, was sind dann weitere mögliche Ursachen? Es hängt auch davon ab, wie wir mit Stress und Unsicherheiten umgehen, was wir überhaupt als negativ stressig bewerten, ob wir im Blick behalten, was im Leben wirklich wichtig und sinnstiftend ist, was zu einem zufriedenen Leben hauptsächlich beiträgt und woran wir den Erfolg unsres Leben messen. Und es hängt damit zusammen, ob wir während unseres bisherigen Lebens gelernt haben mit Unsicherheiten und Stressoren, belastenden Ereignissen und Herausforderungen umzugehen. Je beschützter wir aufwachsen, je mehr Probleme und Schwierigkeiten von uns ferngehalten werden oder wir ihnen aus dem Weg gehen, desto weniger trainieren wir unsere Kompetenzen mit Herausforderungen umzugehen, desto weniger Handlungs-Repertoire haben wir. Damit steigt unsere Angst, denn das, was wir nicht kennen und können, ängstigt uns noch mehr und lässt uns genau solche Situationen tendenziell erneut vermeiden; ein ungünstiger Kreislauf, der manchmal auch als „Hamsterrad“ bezeichnet wird. Von innen sieht ein Hamsterrad auch mal aus wie eine Karriereleiter. Wir machen uns abhängig von der Bewertung anderer, von durch die Medien und Werbung vorgegebene vermeintliche Bedürfnisse und deren Befriedigung und vergessen darüber, was wirklich wichtig im Leben ist, weil wir zu wenig reflektieren und Perspektivwechsel vornehmen. Wir sind nicht mehr gerne mit uns und unseren Gedanken alleine, – auch wieder aus einer Angst heraus-, denn es könnte sich ja zeigen, dass das was wir tun, wie wir leben, doch nicht das ist, was unseren Werten entspricht und wir wirklich wollen. Also treten wir weiter in der Mühle.
Wertschätzendes Führungsverhalten wirkt sich positiv auf die Mitarbeiterebene aus
Wie kommen wir also als Gesellschaft wieder zurück zu einem Gefühl von Selbstwirksamkeit, Selbstbestimmung und zu unserer seelischen Widerstandsfähigkeit? Zunächst die Frage, was Unternehmen dazu beitragen können, damit Mitarbeiter*innen sich weniger selbst ausbrennen aber auch weniger verheizt werden – und mir ist dabei wichtig zu betonen, dass den Unternehmen, die ja der Treibstoff einer Gesellschaft sind, hierbei eine enorme Verantwortung obliegt. Im Prinzip ist es ganz einfach und kostet nicht mal viel Geld oder Zeit: Wertschätzung leben, den Mensch wieder in den Fokus rücken, ein humanistischer Umgang miteinander auch mit sich selbst, denn Führungskräfte haben eine nicht zu unterschätzende Vorbildfunktion, Reflexion der Führungs- und Unternehmenswerte und vor allem Überdenken der Definition von Erfolg und der Überzeugung, dass dieser nur an Zahlen gemessen werden kann. In zahlreichen Studien konnte belegt werden, dass das Führungsverhalten direkten negativen aber auch positiven Einfluss auf die psychische Gesundheit und das Stressempfinden der Mitarbeiter hat und, dass durch Führungskräfteschulungen nachhaltig Prävention betrieben werden kann. Und was kann nun jede*r für sich tun?: Nicht darauf warten, dass sich andere, das Unternehmen, das System ändern werden und damit dann alles „besser“ wird. Sich nicht als Opfer der Umstände sehen und über die Umstände „verzweifeln“, sondern aktiv reflektieren und hinterfragen: „was kann ich konkret ändern?“ Was könnte das sein? Die positive Psychologie (nach Martin Seligman) und die Resilienzforschung bieten einige sehr einfache aber enorm wirkungsvolle Methoden: sich in Dankbarkeit zu üben ist mein Favorit. Indem wir uns täglich vor Augen führen, wofür wir dankbar sind, reduzieren wir – das zeigen etliche Studien – unsere Gefühle von Neid und Missgunst sowie unser Stresserleben, und verbessern unseren Umgang mit Unsicherheiten.
Ein Leben ohne Stress, Sorgen und Ängste gibt es nicht
Neues ängstigt uns nicht so sehr, Unsicherheiten rauben uns nicht mehr den Schlaf, wir werden gelassener, weil wir uns auf das besinnen, was wir haben, was positiv ist. Wenn wir uns dann noch um ein gutes soziales Netz kümmern, das ist nämlich der wichtigste Faktor für ein zufriedenes Leben (nicht Ruhm, beruflicher Erfolg oder gar Geld), uns ein wenig in Achtsamkeit üben um den gegenwärtigen Moment wahrzunehmen, -das einzige, was wir wirklich haben-, und unsere sogenannten Glaubenssätze oder innere Antreiber (z.B. „ich muss es allen recht machen“, „ich möchte von allen gemocht werden“, „ich muss perfekt sein“) hinterfragen und reduzieren, dann leben wir auch in der „VUCA – Welt“ ein gutes und selbstbestimmtes Leben. Ein Leben ohne Ängste und Sorgen, ohne Schwierigkeiten, Konflikte, Trauer, Krankheit und Tod gibt es nicht. Allerdings sind wir in der Lage das alles gut zu bewältigen. „Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen“, sagte schon Aristoteles.
Der Artikel ist zuerst hier erschienen: https://www.angstselbsthilfe.de/macht-arbeit-psychisch-krank/